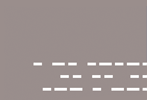Mitten im Ruhrgebiet ist der berühmte "Pulsschlag aus Stahl" verstummt. Kaum merklich erobert die Natur sich Hallen und Industrieanlagen zurück, die Förderbänder stehen still, die Kühltürme sind leer - nach nur acht Jahren Betriebszeit wurde die 1,3 Milliarden DM teure, hypermoderne Kokerei Kaiserstuhl im Dezember 2000 stillgelegt.
Frühjahr 2003: Ein chinesischer Arbeiter im Blaumann geht über das kolossale Werksgelände und malt Schriftzeichen auf Stahlträger und an Wände. Im Dortmunder Norden entsteht ein neuer Mikrokosmos, ein eigenes Stück China - dynamisch und effektiv. Für rund 400 Chinesen wird ein Wohncontainerdorf errichtet - mit Aufenthaltsräumen, eigener Großküche inklusive Riesenwoks und Satellitenschüssel fürs Heimatfernsehen. Hungrig nach Reichtum und Statussymbolen der westlichen Industriestaaten, sind neben dem chinesischen Projektleiter MO LISHI, einer jungen ÜBERSETZERIN und ein paar KÖCHEN unzählige DEMONTAGEARBEITER nach Deutschland gekommen, um ihrem Heimatland ein weiteres "Souvenir aus Stahl" zu bescheren. Hoch motivierte Menschen aus einem Niedriglohnland treffen auf finanziell abgesicherte, aber perspektivenlose Arbeiter einer Industrienation - deren einstige Quelle von Macht und Wohlstand installieren sie kurzerhand bei sich zu Hause.
Die Demontage von Kaiserstuhl vollzieht sich in Windeseile, angetrieben durch den permanenten Druck der Konzernleitung und ein paar wenige Prämien: Alle vier Wochen küren die Chinesen die sieben Fleißigsten unter ihnen zum "Arbeiter des Monats" - das entsprechende Foto mit roter Papierblumenschärpe ziert die Kantinenwände gemeinsam mit einer blumigen, aber immerzu linientreuen, schriftlichen Auszeichnung.
Die deutschen "Stillstandsverwalter" sehen derweil hilflos mit an, wie ihr Arbeitsplatz in handliche Stücke zerlegt wird: Auf Kaiserstuhl, wo früher bis zu 800 Menschen tätig waren, betreuen nun die letzten dreißig Arbeiter den so genannten Stillstandsbereich - unter ihnen die Elektriker RAINER KRUSKA (53) und WERNER VOGT (52).
Bei den Deutschen, die den Abbau der Anlage logistisch unterstützen sollen, herrscht Skepsis und Distanz gegenüber den ausländischen Kollegen und ihren als leichtsinnig empfundenen Methoden. Die Verständigung ist kompliziert, Missverständnisse an der Tagesordnung. Um 10 Uhr morgens ist bereits die halbe Schicht der deutschen Belegschaft vorbei. In der Frühstückspause unterhält man sich bei Filterkaffee und Stullen über die finanziellen Einbußen im Vorruhestand und spekuliert über Lebenseinstellung, Arbeitsweise und Kochkünste der Chinesen. Die Demontage ist nicht aufzuhalten und führt den Verlust der Industriearbeit in Deutschland, ja in ganz Europa, täglich vor Augen. Für die Arbeiter aus dem Ruhrgebiet ist dies ein tiefer Stich ins Herz, haben sie doch ihr Leben lang als Koker gearbeitet.
Der Arbeitstag der Chinesen ist deutlich länger: Sechzig Stunden in der Woche arbeiten sie, leben genügsam und sparen jeden verdienten Cent für zu Hause: Einige wollen ihren Kindern eine bessere Ausbildung ermöglichen, LIU GUO HENG spart für eine heiß ersehnte, aber kostspielige Hochzeit, der Koch will Aktien seines Arbeitgebers kaufen, an dessen Erfolg er zunehmend glaubt. Doch zunächst gilt es, die Mission in der Fremde zu beenden - ganze eineinhalb Jahre ohne einen einzigen Besuch zu Hause. Chinesisches Fernsehen und seltene Telefonate mit Frau und Kind stellen für die Männer dabei die einzigen Verbindungen in die Heimat dar. "Sag noch einmal Papa zu mir" heißt es hier, und Tausende von Kilometern entfernt wird dem fehlenden Vater ein Lied vorgesungen. Allesamt leidvolle Versuche, den Nächsten in der Ferne irgendwie nah zu sein.
Deutschland oder auch nur Dortmund kennen zu lernen, dazu fehlt den Chinesen die Zeit und das Geld, denn schon die Busfahrkarte in die Stadt scheint bei einem - gemessen an chinesischem Standard - üppigen Monatslohn von umgerechnet 400 Euro unerschwinglich. Allein der Projektleiter Mo Lishi ist imstande, ab und an in die Stadt zu fahren - vorzugsweise zur Mercedes-Filiale, wo er Stahl in der für ihn schönsten Form bestaunt. "Dieser Wagen ist 'very good'", meint er zufrieden und strahlt über das ganze Gesicht. "Den nehm� ich gleich mit nach Hause." Sein winziges Kabuff auf Kaiserstuhl, in dem er lebt und arbeitet, hat er längst mit einem Mercedes-Werbeplakat geschmückt, das einen alten und neuen Wagen des deutschen Automobilherstellers zeigt. Davon inspiriert, hat Mo Lishi ein paar persönliche Zeilen geschrieben: Über die einen, die gehen, und die anderen, die kommen und ein verheißungsvolles Leben erwarten. Denn Mo Lishi ist davon überzeugt: Schon bald wird er in einem neuen Wagen einer besseren Zukunft entgegenfahren - so wie ganz China. Bei seinem nächsten Besuch in Deutschland, so Mo Lishi, will er die deutschen Airbus-Fabriken in die Heimat mitnehmen.
Zu Kontakten zwischen den deutschen und chinesischen Arbeitern kommt es kaum, sie belauern sich gegenseitig: Die Arbeitsinstrumente der Deutschen sind Vorschriften und Bestimmungen zu Sicherheit und Umweltschutz, die von den Neuankömmlingen gerne ignoriert werden. Trickreich versuchen sie, diese zu umgehen, schließlich sind die "alten Ausländer" kaum acht Stunden auf dem Gelände, und was sie nicht sehen, kann nicht geahndet werden. Doch die verbliebenen deutschen Arbeiter pochen auf Kaiserstuhl vehement auf ihr Hausrecht - bis zur bitteren Neige. Fachmännisch kontrolliert Kruska, dass die Chinesen nicht einfach "machen was sie wollen": Improvisierte Stromanschlüsse werden lahmgelegt, mit Draht aneinander montierte Leitern vom Dach weggezogen und entsorgt, Schweißverordnungen noch zum x-ten Mal zitiert. Es scheint, als könnten die Deutschen nicht loslassen, als wollten sie unbewusst den Abbruch verzögern und sich partout nicht mit dem endgültigen Machtverlust und der Rollenumkehr abfinden. Die Sicht auf die deutsche Genauigkeit im Umgang mit Vorschriften wandelt sich allerdings, als ein chinesischer Arbeiter bei einem Unfall fast zu Tode kommt - "Arbeitspannen", denen nichts entgegengesetzt wird als Mao-Zitate.
Beim letzten Gang über das zur Trümmerlandschaft mutierte Kokerei-Gelände öffnet Kruska Stromkästen und Türen, drückt mechanisch längst funktionslose Schalter, blickt in ausgeweidete Kabelschächte und bemüht sich, den Schein eines Routinegangs aufrecht zu erhalten. Kruska und seine deutschen Kollegen haben sich verändert in den letzten Wochen des Abbaus: Das siegesbewusst proklamierte "Die werden schon sehen, das funktioniert nicht!" ist gewichen. Sie sind zunehmend angespannt und traurig, denn mit dem Arbeitsplatz verlieren sie auch ein Stück Heimat. Unsicherheit macht sich breit, was die anstehenden Veränderungen konkret für das eigene Leben bedeuten: Wie beschäftigt man sich, und wie hält man die neue, permanente Nähe zu seiner Frau aus? Noch bevor das Werk ganz demontiert ist, werden Kruska und Vogt in die so genannte "Kurzarbeit 0", dann in die "Anpassung" und schließlich in den Vorruhestand versetzt. Alle diese Begriffe umschreiben unzureichend die Tatsache, dass es in dieser Gesellschaft für sie keine Arbeit mehr gibt, sie selbst und ihr ganzes Berufsbild scheinen nicht mehr gebraucht zu werden. Wie sich jedoch im Nachhinein herausstellt, waren die wirtschaftlichen Prognosen falsch und der Verkauf der Kokerei ein großer Fehler: Inzwischen herrscht auf dem Weltmarkt ein enormer Mehrbedarf an Koks, nicht zuletzt durch die boomende Wirtschaft in China selbst. Der Preis pro Tonne Koks stieg in den Jahren nach der Stillegung von Kaiserstuhl von 30 auf 550 Dollar " als hätte die Globalisierung einen bitteren Sinn für Ironie und sich ausgerechnet Dortmund-Mitte für ihre Pointe ausgesucht.
Frühjahr 2003: Ein chinesischer Arbeiter im Blaumann geht über das kolossale Werksgelände und malt Schriftzeichen auf Stahlträger und an Wände. Im Dortmunder Norden entsteht ein neuer Mikrokosmos, ein eigenes Stück China - dynamisch und effektiv. Für rund 400 Chinesen wird ein Wohncontainerdorf errichtet - mit Aufenthaltsräumen, eigener Großküche inklusive Riesenwoks und Satellitenschüssel fürs Heimatfernsehen. Hungrig nach Reichtum und Statussymbolen der westlichen Industriestaaten, sind neben dem chinesischen Projektleiter MO LISHI, einer jungen ÜBERSETZERIN und ein paar KÖCHEN unzählige DEMONTAGEARBEITER nach Deutschland gekommen, um ihrem Heimatland ein weiteres "Souvenir aus Stahl" zu bescheren. Hoch motivierte Menschen aus einem Niedriglohnland treffen auf finanziell abgesicherte, aber perspektivenlose Arbeiter einer Industrienation - deren einstige Quelle von Macht und Wohlstand installieren sie kurzerhand bei sich zu Hause.
Die Demontage von Kaiserstuhl vollzieht sich in Windeseile, angetrieben durch den permanenten Druck der Konzernleitung und ein paar wenige Prämien: Alle vier Wochen küren die Chinesen die sieben Fleißigsten unter ihnen zum "Arbeiter des Monats" - das entsprechende Foto mit roter Papierblumenschärpe ziert die Kantinenwände gemeinsam mit einer blumigen, aber immerzu linientreuen, schriftlichen Auszeichnung.
Die deutschen "Stillstandsverwalter" sehen derweil hilflos mit an, wie ihr Arbeitsplatz in handliche Stücke zerlegt wird: Auf Kaiserstuhl, wo früher bis zu 800 Menschen tätig waren, betreuen nun die letzten dreißig Arbeiter den so genannten Stillstandsbereich - unter ihnen die Elektriker RAINER KRUSKA (53) und WERNER VOGT (52).
Bei den Deutschen, die den Abbau der Anlage logistisch unterstützen sollen, herrscht Skepsis und Distanz gegenüber den ausländischen Kollegen und ihren als leichtsinnig empfundenen Methoden. Die Verständigung ist kompliziert, Missverständnisse an der Tagesordnung. Um 10 Uhr morgens ist bereits die halbe Schicht der deutschen Belegschaft vorbei. In der Frühstückspause unterhält man sich bei Filterkaffee und Stullen über die finanziellen Einbußen im Vorruhestand und spekuliert über Lebenseinstellung, Arbeitsweise und Kochkünste der Chinesen. Die Demontage ist nicht aufzuhalten und führt den Verlust der Industriearbeit in Deutschland, ja in ganz Europa, täglich vor Augen. Für die Arbeiter aus dem Ruhrgebiet ist dies ein tiefer Stich ins Herz, haben sie doch ihr Leben lang als Koker gearbeitet.
Der Arbeitstag der Chinesen ist deutlich länger: Sechzig Stunden in der Woche arbeiten sie, leben genügsam und sparen jeden verdienten Cent für zu Hause: Einige wollen ihren Kindern eine bessere Ausbildung ermöglichen, LIU GUO HENG spart für eine heiß ersehnte, aber kostspielige Hochzeit, der Koch will Aktien seines Arbeitgebers kaufen, an dessen Erfolg er zunehmend glaubt. Doch zunächst gilt es, die Mission in der Fremde zu beenden - ganze eineinhalb Jahre ohne einen einzigen Besuch zu Hause. Chinesisches Fernsehen und seltene Telefonate mit Frau und Kind stellen für die Männer dabei die einzigen Verbindungen in die Heimat dar. "Sag noch einmal Papa zu mir" heißt es hier, und Tausende von Kilometern entfernt wird dem fehlenden Vater ein Lied vorgesungen. Allesamt leidvolle Versuche, den Nächsten in der Ferne irgendwie nah zu sein.
Deutschland oder auch nur Dortmund kennen zu lernen, dazu fehlt den Chinesen die Zeit und das Geld, denn schon die Busfahrkarte in die Stadt scheint bei einem - gemessen an chinesischem Standard - üppigen Monatslohn von umgerechnet 400 Euro unerschwinglich. Allein der Projektleiter Mo Lishi ist imstande, ab und an in die Stadt zu fahren - vorzugsweise zur Mercedes-Filiale, wo er Stahl in der für ihn schönsten Form bestaunt. "Dieser Wagen ist 'very good'", meint er zufrieden und strahlt über das ganze Gesicht. "Den nehm� ich gleich mit nach Hause." Sein winziges Kabuff auf Kaiserstuhl, in dem er lebt und arbeitet, hat er längst mit einem Mercedes-Werbeplakat geschmückt, das einen alten und neuen Wagen des deutschen Automobilherstellers zeigt. Davon inspiriert, hat Mo Lishi ein paar persönliche Zeilen geschrieben: Über die einen, die gehen, und die anderen, die kommen und ein verheißungsvolles Leben erwarten. Denn Mo Lishi ist davon überzeugt: Schon bald wird er in einem neuen Wagen einer besseren Zukunft entgegenfahren - so wie ganz China. Bei seinem nächsten Besuch in Deutschland, so Mo Lishi, will er die deutschen Airbus-Fabriken in die Heimat mitnehmen.
Zu Kontakten zwischen den deutschen und chinesischen Arbeitern kommt es kaum, sie belauern sich gegenseitig: Die Arbeitsinstrumente der Deutschen sind Vorschriften und Bestimmungen zu Sicherheit und Umweltschutz, die von den Neuankömmlingen gerne ignoriert werden. Trickreich versuchen sie, diese zu umgehen, schließlich sind die "alten Ausländer" kaum acht Stunden auf dem Gelände, und was sie nicht sehen, kann nicht geahndet werden. Doch die verbliebenen deutschen Arbeiter pochen auf Kaiserstuhl vehement auf ihr Hausrecht - bis zur bitteren Neige. Fachmännisch kontrolliert Kruska, dass die Chinesen nicht einfach "machen was sie wollen": Improvisierte Stromanschlüsse werden lahmgelegt, mit Draht aneinander montierte Leitern vom Dach weggezogen und entsorgt, Schweißverordnungen noch zum x-ten Mal zitiert. Es scheint, als könnten die Deutschen nicht loslassen, als wollten sie unbewusst den Abbruch verzögern und sich partout nicht mit dem endgültigen Machtverlust und der Rollenumkehr abfinden. Die Sicht auf die deutsche Genauigkeit im Umgang mit Vorschriften wandelt sich allerdings, als ein chinesischer Arbeiter bei einem Unfall fast zu Tode kommt - "Arbeitspannen", denen nichts entgegengesetzt wird als Mao-Zitate.
Beim letzten Gang über das zur Trümmerlandschaft mutierte Kokerei-Gelände öffnet Kruska Stromkästen und Türen, drückt mechanisch längst funktionslose Schalter, blickt in ausgeweidete Kabelschächte und bemüht sich, den Schein eines Routinegangs aufrecht zu erhalten. Kruska und seine deutschen Kollegen haben sich verändert in den letzten Wochen des Abbaus: Das siegesbewusst proklamierte "Die werden schon sehen, das funktioniert nicht!" ist gewichen. Sie sind zunehmend angespannt und traurig, denn mit dem Arbeitsplatz verlieren sie auch ein Stück Heimat. Unsicherheit macht sich breit, was die anstehenden Veränderungen konkret für das eigene Leben bedeuten: Wie beschäftigt man sich, und wie hält man die neue, permanente Nähe zu seiner Frau aus? Noch bevor das Werk ganz demontiert ist, werden Kruska und Vogt in die so genannte "Kurzarbeit 0", dann in die "Anpassung" und schließlich in den Vorruhestand versetzt. Alle diese Begriffe umschreiben unzureichend die Tatsache, dass es in dieser Gesellschaft für sie keine Arbeit mehr gibt, sie selbst und ihr ganzes Berufsbild scheinen nicht mehr gebraucht zu werden. Wie sich jedoch im Nachhinein herausstellt, waren die wirtschaftlichen Prognosen falsch und der Verkauf der Kokerei ein großer Fehler: Inzwischen herrscht auf dem Weltmarkt ein enormer Mehrbedarf an Koks, nicht zuletzt durch die boomende Wirtschaft in China selbst. Der Preis pro Tonne Koks stieg in den Jahren nach der Stillegung von Kaiserstuhl von 30 auf 550 Dollar " als hätte die Globalisierung einen bitteren Sinn für Ironie und sich ausgerechnet Dortmund-Mitte für ihre Pointe ausgesucht.